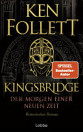Der Staatsbegriff im petrinischen Russland
Gundula Helmert
जाने २०२१ · Duncker & Humblot
ई-पुस्तक
357
पेज
reportरेटिंग आणि परीक्षणे यांची पडताळणी केलेली नाही अधिक जाणून घ्या
या ई-पुस्तकाविषयी
Das Buch behandelt die herrschaftstheoretischen, sozialen und instrumentellen Komponenten des russischen Absolutismus unter Peter I. (1689 - 1725). Als Quellengrundlage dienen sämtliche Gesetze der Epoche, Briefe des Zaren, Schriften seines Chefideologen Feofan Prokopovic, Darstellungen russischer Zeitzeugen sowie Berichte ausländischer Diplomaten.
Folgende Ergebnisse zeichnen sich ab: Die Weite des Raumes bewirkte eine Asymmetrie der Macht, die darin bestand, daß der Wille des Herrschers zwar in seiner unmittelbaren Umgebung bestimmend war, nicht jedoch an der Peripherie des Reiches. Den multinationalen Charakter der Bevölkerung suchte man offiziell herunterzuspielen. Anders als im westeuropäischen Ständestaat knüpfte der russische Absolutismus nahtlos an die Strukturen der Moskauer Autokratie an, wobei die Machtmittel nach westlichen Standards modernisiert wurden. Ergänzend zu den gewohnten Legitimationstopoi der Zarenherrschaft - Tradition und göttlicher Wille - fand neu der westeuropäische Begriff des Allgemeinwohls Eingang in die russische Staatstheorie, ohne daß Zar oder Senat diesen Wert klar definieren konnten. Die Wirtschaftspraxis trug merkantilistische Züge. Gesellschaftspolitisch zeichneten sich Nivellierungstendenzen ab. Um Rußland eine Vormachtstellung unter den Großmächten zu erkämpfen, führte Zar Peter fast ununterbrochen Angriffskriege und brachte sich damit in Gegensatz zu allen Schichten der Bevölkerung, die unter steigenden Belastungen litt. Hinsichtlich seines Hegemonialstrebens, der Vorliebe für Mammutprojekte, des Einsatzes von Zwangsarbeit und der skrupellosen Ausschaltung innenpolitischer Gegner könnte Peter I. als Ziehvater Stalins aufgefaßt werden.
Folgende Ergebnisse zeichnen sich ab: Die Weite des Raumes bewirkte eine Asymmetrie der Macht, die darin bestand, daß der Wille des Herrschers zwar in seiner unmittelbaren Umgebung bestimmend war, nicht jedoch an der Peripherie des Reiches. Den multinationalen Charakter der Bevölkerung suchte man offiziell herunterzuspielen. Anders als im westeuropäischen Ständestaat knüpfte der russische Absolutismus nahtlos an die Strukturen der Moskauer Autokratie an, wobei die Machtmittel nach westlichen Standards modernisiert wurden. Ergänzend zu den gewohnten Legitimationstopoi der Zarenherrschaft - Tradition und göttlicher Wille - fand neu der westeuropäische Begriff des Allgemeinwohls Eingang in die russische Staatstheorie, ohne daß Zar oder Senat diesen Wert klar definieren konnten. Die Wirtschaftspraxis trug merkantilistische Züge. Gesellschaftspolitisch zeichneten sich Nivellierungstendenzen ab. Um Rußland eine Vormachtstellung unter den Großmächten zu erkämpfen, führte Zar Peter fast ununterbrochen Angriffskriege und brachte sich damit in Gegensatz zu allen Schichten der Bevölkerung, die unter steigenden Belastungen litt. Hinsichtlich seines Hegemonialstrebens, der Vorliebe für Mammutprojekte, des Einsatzes von Zwangsarbeit und der skrupellosen Ausschaltung innenpolitischer Gegner könnte Peter I. als Ziehvater Stalins aufgefaßt werden.
या ई-पुस्तकला रेटिंग द्या
तुम्हाला काय वाटते ते आम्हाला सांगा.
वाचन माहिती
स्मार्टफोन आणि टॅबलेट
Android आणि iPad/iPhone साठी Google Play बुक अॅप इंस्टॉल करा. हे तुमच्या खात्याने आपोआप सिंक होते आणि तुम्ही जेथे कुठे असाल तेथून तुम्हाला ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन वाचण्याची अनुमती देते.
लॅपटॉप आणि कॉंप्युटर
तुम्ही तुमच्या काँप्युटरचा वेब ब्राउझर वापरून Google Play वर खरेदी केलेली ऑडिओबुक ऐकू शकता.
ईवाचक आणि इतर डिव्हाइसेस
Kobo eReaders सारख्या ई-इंक डिव्हाइसवर वाचण्यासाठी, तुम्ही एखादी फाइल डाउनलोड करून ती तुमच्या डिव्हाइसवर ट्रान्सफर करणे आवश्यक आहे. सपोर्ट असलेल्या eReaders वर फाइल ट्रान्सफर करण्यासाठी, मदत केंद्र मधील तपशीलवार सूचना फॉलो करा.